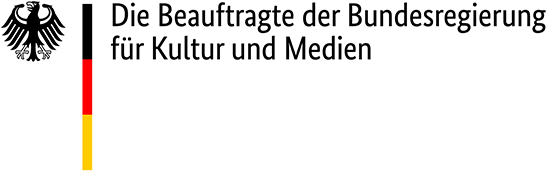„Das eine Judentum gibt es nicht! Das Judentum hat viele Gesichter!“
Interview mit Uwe von Seltmann

Uwe von Seltmann ist Journalist, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Rechercheur. Der ehemalige Chefredakteur von Wochen- und Fachzeitschriften beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten sowohl mit der jüdischen Kultur und Geschichte als auch mit den familiären, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der NS-Zeit auf die Gegenwart. Zum Festjahr #2021JLID veröffentlicht er nun im Erlanger homunculus Verlag das 344-seitige erzählende Sachbuch „Wir sind da! 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt.
1. Am 5. März erscheint Ihr neues Sachbuch „Wir sind da! 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Hier behandeln Sie ein vielseitiges Bild der über 1700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bis hin zur Gegenwart. Wie kommt es, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema „jüdisches Leben“ beschäftigen?
Mit dem jüdischen Leben beschäftige ich mich seit meiner Kindheit. Ich bin in einem Dorf in Westfalen aufgewachsen, in dem damals noch vier Generationen unter einem Dach lebten. Und alle drei Generationen vor mir haben mich in der „Liebe zum Volk Israel“, wie man in meiner Familie sagte, erzogen – von meinen Urgroßeltern Laura und Heinrich Marburger bis zu meinem Vater, der in den 1970er Jahren an deutsch-israelischen Lehreraustauschen teilgenommen hatte und uns Kinder mit dem hebräischen Gute-Nacht-Wunsch „layla tov“ ins Bett schickte. Ich hatte schon immer gerne gelesen, und das Bücherregal meines Vaters war eine Fundgrube zu jüdischen Themen. Als Jugendlicher habe ich alles von Joseph Roth und Stefan Zweig verschlungen; sie sind bis heute meine Lieblingsschriftsteller. Auch meine beiden Lieblingsmusiker sind bzw. waren Juden: Bob Dylan und Leonard Cohen. Weil ich die biblischen Geschichten im Original lesen wollte, habe ich das alte Hebräisch gelernt. In den 1990er Jahren wurde während meiner Zeit in Jerusalem der Religionsphilosoph und Schriftsteller Schalom Ben-Chorin (geboren 1913 in München als Fritz Rosenthal) zu einem wichtigen Lehrer für mich. Er brachte mir seine Gedankenwelt und die des großen Martin Buber nahe. Ab etwa 2000 habe ich mich mehr und mehr mit einer Sprache und Kultur beschäftigt, die mich ebenfalls bereits als Jugendlicher fasziniert hatte: mit der jiddischen. Das Jiddischland, das keine Grenzen kennt und dessen Bewohnerinnen und Bewohner auf allen Kontinenten leben, ist zu meinem Heimatland geworden – egal, wo ich gerade lebe.
2. Sie haben bereits bemerkenswerte Werke zur Erinnerungskultur beigetragen. Ihr erster Roman, „Karlebachs Vermächtnis“ handelt von den Auswirkungen der NS-Zeit auf die Gegenwart. Ihr letztes Buch, „Es brennt“ (2018), ist eine Biografie des Krakauer jiddischen Dichters Mordechai Gebirtig (1877–1942). In „Wir sind da!“ behandeln Sie das blühende, vielstimmige jüdische Leben von heute – ein Thema, das in der deutschen Sachbuch-Literatur bis jetzt wenig Gehör fand. Haben Sie sich schon immer mit diesem Thema beschäftigt oder war dieser Perspektivwechsel ein Prozess?
Es war ein langer Prozess, der mich – über viele nicht nur geographischen Umwege – zurück zu den Wurzeln geführt hat, zurück nach Deutschland. Ich habe 2004 in dem Buch „Schweigen die Täter, reden die Enkel“ die Recherche nach meinem österreichischen Großvater öffentlich gemacht, der in unserer Familie ein Tabu war; mein Vater ist als Vollwaise aufgewachsen. Ich habe einen SS-Offizier und Judenmörder als Großvater und bin mit einer polnischen Jüdin verheiratet, deren Großvater in Auschwitz ermordet wurde – das hat meinen Blick auf die Geschichte, auf die Nachwirkungen der Vergangenheit in die Gegenwart und das durch nationalistisch-rassistisch-antisemitische Bewegungen gefährdete Zusammenleben der Gegenwart nachhaltig geprägt. Ob in Lemberg (Lviv), Czernowitz, Odessa, Krakau oder Warschau – anfangs ohne es zu ahnen und später dann bewusst, habe ich versucht, das Gegenteil von dem zu tun, was mein SS-Großvater getan hatte: mich in verschiedenen Projekten der Erinnerung an das weitgehend vernichtete ostjüdische Leben zu widmen. Diese Projekte fanden einen – vorläufigen? – Abschluss in meiner Biografie über den jiddischen Dichter Mordechai Gebirtig. „Wir sind da!“ habe ich nun den in der Schoah ermordeten österreichisch-ungarischen Seltmanns und hessisch-westfälischen Marburgers gewidmet. Einfache Landjuden wie die Marburgers haben bis zur Schoah das jüdische Leben in Deutschland ebenso geprägt wie die Einsteins, Bubers und Baecks.
Heute prägen die aus der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten stammenden Jüdinnen und Juden das jüdische Leben Deutschlands. In Begegnungen mit ihnen kommt mir ein bisschen zugute, dass ich bereits vor 1989 viel im „Ostblock“ unterwegs war und mich intensiv mit der Geschichte und Kultur des Ostjudentums beschäftigt habe. Wenn ich unter ihnen auf jemanden treffe, der oder die Jiddisch spricht, ist die Freude auf beiden Seiten groß.
3. In der NS-Zeit trat der Hass gegenüber Juden deutlich und offen zu Tage. Heute äußert sich Antisemitismus anders. Wie ist Ihnen dieser in Ihren Recherchen begegnet?
Anfangs war mein Gedanke, das Thema „Antisemitismus“ möglichst klein zu halten. Das Attentat des Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle am Jom-Kippur-Fest 2019 hat es dann ausführlicher in mein Blickfeld gerückt. Ich wohnte damals seit zwölf Jahren in Kazimierz, dem ehemaligen jüdischen Viertel von Krakau, in dem bis heute sieben Synagogen stehen und zahlreiche jüdische Einrichtungen ihren Sitz haben. Obwohl in Polen bis in die Regierung hinein der Antisemitismus verbreitet ist, muss dennoch kein jüdisches Gebäude von der Polizei bewacht werden. Als mir bei meinen Recherchen und in Gesprächen mit meinem deutschen jüdischen Freundeskreis das Ausmaß des Antisemitismus in Deutschland bewusst wurde, war ich schockiert – und habe versucht, das Phänomen des Antisemitismus von seinen Anfängen bis heute zu erklären. Den Abschnitt zur Gegenwart habe ich schließlich mit „Bedrohte Vielfalt“ überschrieben. Ich plädiere mehr und mehr dafür, dass Fremdwort „Antisemitismus“ zu vermeiden und klar beim Namen zu nennen, was es meint: Feindschaft und Hass gegen Jüdinnen und Juden.
4. Die Mehrheitsgesellschaft weiß sehr wenig über jüdisches Leben der Gegenwart. Wieso, meinen Sie, halten sich Vorurteile und Irrglauben und Berührungsängste bis heute?
Die Unkenntnis der Mehrheitsgesellschaft über das jüdische Leben in Geschichte und Gegenwart ist für mich erschreckend. Diese Unkenntnis hat meines Erachtens vor allem zwei Ursachen: Die unbewältigten Familiengeschichten unter den Nachfahren der NS-Täter machen es vielen Nichtjuden unmöglich, Jüdinnen und Juden unbefangen zu begegnen. Martin Buber würde diese Kontakte als „Zergegnungen“ bezeichnen. Diese „Zergegnungen“ äußern sich auf vielfältige Weise. Die NS-Zeit wirkt in den Nachfahren der Täter weiter – ob es ihnen passt oder nicht.
Darüber hinaus ist Deutschland das einzige Land in Europa, in dem seit der Antike durchgehend Juden leben. Das heißt: In der Weitergabe der christlich begründeten Judenfeindschaft – sie hat ihre Ursprünge bereits im Neuen Testament – gab es nie einen Traditionsbruch zwischen den Generationen. Der christliche Antisemitismus mündete Ende des 19. Jahrhunderts in den rassischen, der Juden als eine den Deutschen/Germanen/Ariern gegenüber minderwertige Rasse betrachtete – mit fatalen Folgen: Nun bestand der Gegensatz nicht mehr aus Christen und Juden, sondern aus Deutschen und Juden. Dieser vermeintliche Gegensatz ist in vielen nichtjüdischen Köpfen und Herzen auch nach der Schoah, der von Deutschen verantworteten Ermordung von sechs Millionen europäischen Jüdinnen und Juden, bis heute präsent. Wie tief diese judenfeindlichen Stereotype weiterwirken, zeigt sich bei Corona-Leugnern, die sich einen Judenstern anheften oder von einer „Weltverschwörung“ faseln.
5. Sie haben auch mehrfach in Israel gelebt und gearbeitet. Wie veränderten diese Aufenthalte Ihr Bild auf das Judentum der Gegenwart?
Während meiner Aufenthalte in Israel habe ich kaum ein Wort Ivrit gelernt. In den 1990er Jahren lebten noch viele Jeckes – Jüdinnen und Juden, die aus Deutschland stammten – in Israel; sie freuten sich, Deutsch zu sprechen. Viele von ihnen hatten zwar ihre Heimat verlassen müssen, aber waren nicht aus ihrer Sprache ausgewandert. Später hatte ich dann vor allem mit polnisch- und jiddischsprachigen Juden Kontakt. Unsere links-liberalen Tel Aviver Freunde haben mich immer für verrückt erklärt, wenn ich mal wieder nach Bnei Brak gefahren bin, das ausschließlich von Ultraorthodoxen bewohnt wird – ich wollte in dieser faszinierend-fremden und aus der Zeit gefallenen Welt meine Jiddisch-Kenntnisse auffrischen. Tel Aviv und Bnei Brak sind, obwohl die beiden Städte ineinander übergehen, Galaxien voneinander entfernt. Die Begegnungen und Gespräche mit Menschen aus sehr unterschiedlichen jüdischen Welten haben mir veranschaulicht, was mir schon Schalom Ben-Chorin eingeschärft hatte: „Das eine Judentum gibt es nicht! Das Judentum hat viele Gesichter!“ Das ist auch im Deutschland des Jahres 2021 so.
6. Sie arbeiten mit am Ziel des Festjahres #2021JLID, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen. Was muss in Deutschland noch geschehen, damit Juden als selbstverständlicher und prägender Teil unserer Gesellschaft, hier sicher und selbstbestimmt leben können?
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach – sie lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Dieser Satz steht in der Thora und auch im Neuen Testament. Er lautet: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Das Tragische ist, dass viele Menschen sich selbst nicht lieben …
Das Buch kann u.a. direkt beim Verlag erworben werden:
ZUM VERLAG